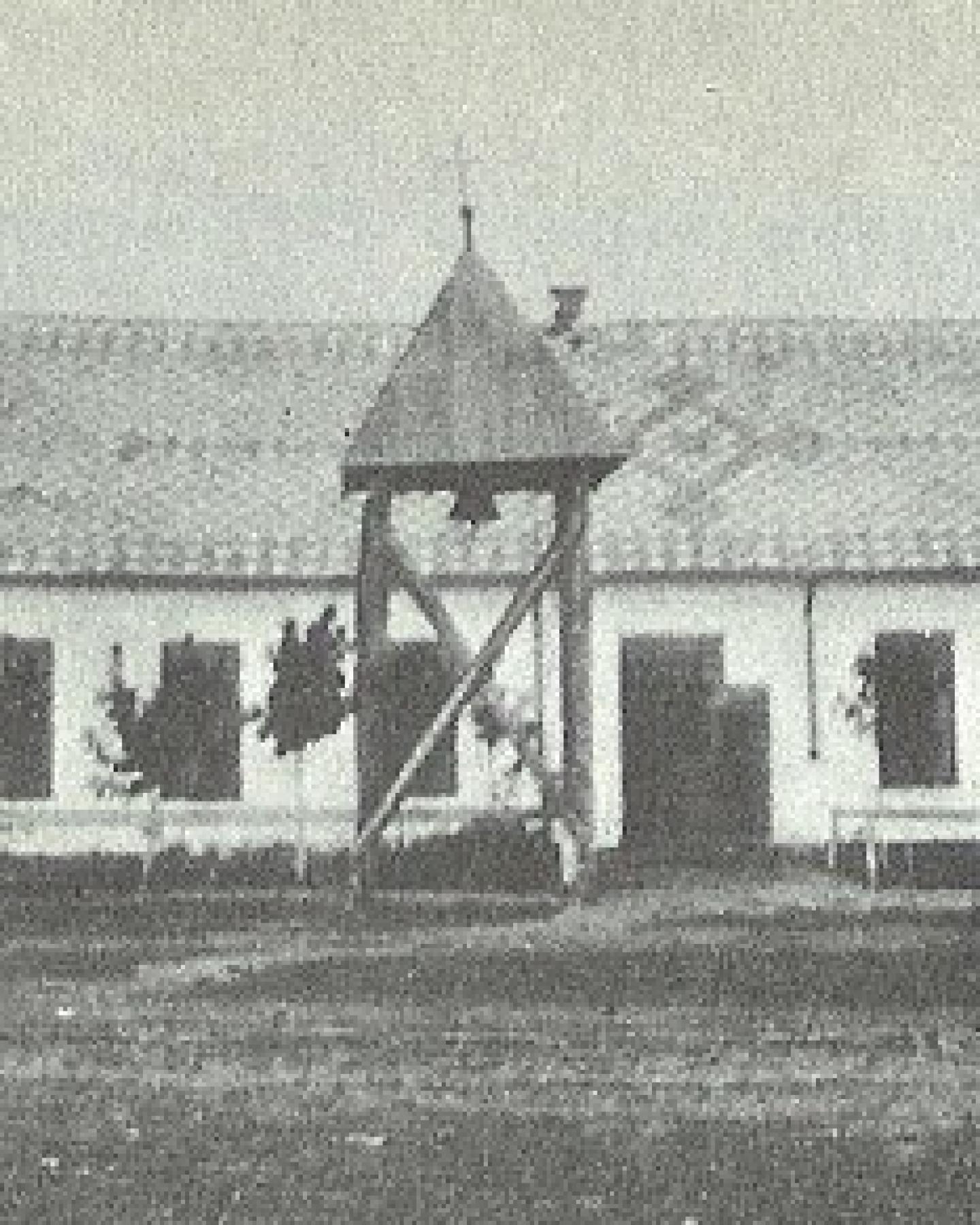Landmenge (Hektar) – bei Gründung/bei Umsiedlung
Bet- und Schulhaus Kurudschika
Lokalisierung
Ukraine
Einwohner
Volkszählung 1930: 721 Deutsche / 23 Andere
Einwohner 1940: 707 Deutsche
Karte
Historie
„Durch Jahrzehnte hindurch hat deutscher Fleiß um ein Fleckchen Erde gerungen, ist unterlegen, hat sich wieder erhoben, hat Katastrophen überlebt, ist endlich zum Eigentümer des Fleckchens geworden, aus der Steppe ist durch ihn ein deutsches Dorf emporgewachsen, das sich vor keinem seiner Nachbarn zu schämen braucht.“ Mit diesen Worten schließen die Chronisten Daniel Erdmann und Edmund Damer, der eine in der Anfangszeit, der andere am Schluss Lehrer in Kurudschika und beide gründliche Kenner der Gemeinde.
Die Vorgeschichte ist eine der interessantesten aller deutschen Gemeinden. Beim Friedensschluss am 16. Mai 1812 in Bukarest zwischen Kaiser Alexander I. und dem türkischen Sultan Selig I II., war auch Staatsrat Anton Fouton als Mitbevollmächtigter des Generals der Infanterie Iwan Sabanejew anwesend. Im Jahre 1824 erhielt er für seine Verdienste 5000 Deßjatinen Land, ein Viereck, das zwischen dem Steppenflüsschen Skinos und Sack liegt und im Süden an die Gemarkung von Kolatschowka und Mintschuna stößt. – Während wir in Bessarabien nie russische Leibeigene antrafen, waren auf diesem Gut leibeigene Kleinrussen angesetzt, von deren Nachfahren 1939 noch eine Familie (Schukowsky) hier lebte. Neben der ersten entstand später noch eine zweite Siedlung auf demselben Gut teils aus Leibeigenen, teils aus Zehntelbauern. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren Leutnant Bernadacki und der Ehrenbürger Günsburg Besitzer, nach letzterem wurde Kuradschika später auch Günsburgsdorf genannt.
Die ersten deutschen Siedler stammten aus den alten Kolonien Bessarabiens; sie waren nach Rumänien ausgewandert, kamen in den vierziger Jahren zurück und wurden in ihren Gemeinden nach einer Bestimmung der Obrigkeit nicht mehr angenommen. Unter ihnen waren zum Beispiel die Familien Kraft aus Leipzig, Motz aus Borodino, Reichenberger und Kirchhöfel aus Beresina und Tarutino. – Um das Jahr 1864 pachteten zwei Bulgaren, die Brüder Peter und Andrei Maradsch, das Gut und teilten es in zwei Hälften. Der eine vertrieb alle Bewohner der beiden kleinrussischen Siedlungen, aber auch die Deutschen aus dem Ort Saki, der ersten deutschen Tochterkolonie Bessarabiens auf dem Gut. Sie zogen in die Kolonien Josefsdorf oder in die alten Kolonien. Mit dem Ende der Pachtzeit des einen dieser Brüder beginnt die Geschichte von Kurudschika.
Eine Pachtparzelle von 2485 Deßjatinen nahmen drei Leipziger Kolonisten, Daniel Buchwitz, Johann Mann und Ludwig Jeschke auf zehn Jahre in Pacht, mit der Verpflichtung, im Verlauf von drei Jahren mindestens dreißig deutsche Unterpächter im Tale Kurudschik in Häusern, nach deutschem Muster gebaut, anzusetzen und in den Höfen Bäume zu pflanzen. Jeder Unterpächter hatte als Pachtzins fünf Maß Getreide abzugeben und nach festgelegten Sätzen für das übrige genutzte Land Pachtzins und von den Haustieren bestimmte Taxen zu zahlen.
Im ersten Jahr nach der Ansiedlung 1881 war die Ernte gering, im zweiten noch schlechter. Die Futternot war so groß, dass man 1883 die Schafe auf die Weide tragen musste; doch wuchs eine gute Ernte heran. Auch 1884 und 1885 war die Ernte gut, dafür fiel sie 1886 durch die Hessenfliege ganz aus. Nach zwei besseren folgten mittlere und 1892 wieder eine totale Missernte. Für ein Spottgeld stieß man das Vieh ab, soweit es nicht eingegangen war. Kurudschika musste öffentlich unterstützt werden; doch wurde geliehenes Geld und Getreide 1893 redlich abgezahlt. 1899 brachte wieder eine folgenschwere Missernte, ebenso 1904; die weiteren Jahre vor dem Ankauf waren mittelmäßig.
Im Jahre 1883 ging das Gut in den Besitz der Gräfin Hatzfeld-Trachtenberg, einer Tochter des Fürsten Manuk-Bey, über. Diese war den deutschen Pächtern wohlgesinnt und förderte sie in ihren gemeinschaftlichen Bestrebungen. Leider waren aber immer noch die Zwischenpächter da, die nur auf ihren Vorteil bedacht waren. Ein großer Teil der Ansiedler wanderte ab oder erwählte sich Kanada zur neuen Heimat. Endlich, im Jahre 1909, gelang es den gebliebenen und den neu hinzugekommenen deutschen Pächtern das Land von der Gräfin käuflich zu erwerben. Die Zahl der Käufer war auf 84 Familien gewachsen; sie erwarben 1681,5 Deßjatinen, von denen die Gräfin, die evangelisch-lutherischen Bekenntnisses war, 13,5 Deßjatinen zum Unterhalt der Kirche und Schule schenkte, indem sie dafür den vollen Kaufwert in bar zurückerstattete. Dass die Ankäufer dieses Geld unter sich aufteilten, ist leider kein Ruhmesblatt, wenn auch ein Platz für die Kirche, Schulhof und Friedhof freigehalten wurde. Nun begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte von Kurudschika. Es ging sichtbar aufwärts. Endlich lichteten sich die Wolken am Himmel. Der Krieg und die Agrarreform 1920 konnte den Besitzern von weniger als 100 Hektar nichts anhaben. Doch kam noch ein harter Schicksalsschlag: die Hochwasserkatastrophe 1927. Drei Meter hoch und mehr brausten die Fluten durch das Dorf. Die Menschen retteten sich auf die Anhöhe, aber die Fluten vernichteten von 117 Häusern 57, darunter die Küsterwohnung; baufällig wurden 23 Wohnhäuser. Der Gesamtschaden wurde auf sechs Millionen Lei abgeschätzt. Doch die Gemeinde verlor den Mut und das Gottvertrauen nicht. Mit äußerster Anstrengung und Mithilfe der deutschen Gemeinden, der Regierung und einer Darlehensaufnahme wurden die Häuser wiederaufgebaut. Die Schultern, die seit der Gründung schwere Lasten trugen, waren auch stark genug, mit Gottes Hilfe diese Last zu tragen. Bei dem wirtschaftlichen Kampf ist es nicht zu verwundern, dass die kulturellen Dinge zu kurz kamen. Doch bestand eine Kirchenbibliothek mit 142 Bänden. Gelesen wurden die kirchlichen Blätter „Christenbote", „Lichter der Heimat”, „Der Wegweiser" in zusammen dreiunddreißig Exemplaren, und die „Deutsche Zeitung Bessarabiens" in sechzehn Exemplaren.
Kirchlich gehörte Kurudschika von 1884 bis 1927 zu Tarutino und wurde als Nebengemeinde dreimal im Jahr bedient; seit 1927 als Hauptgemeinde zu Leipzig. Der Küsterlehrer hielt an den sonstigen Sonntagen Lesegottesdienst und Kinderlehre. Die Brüderversammlungen hatten für entlegene Gemeinden wie Kurudschika eine besondere, segensreiche Bedeutung. Für die kirchlichen und schulischen Räume sorgte man von Anfang an nach Maßgabe der Kraft. Schon 1882 erwarb man von dem Zwischenpächter Mann ein Haus, das als Bethaus und Lehrerwohnung eingerichtet und vom Küsterlehrer bezogen wurde, 1890 wurde eine Änderung und Verbesserung durchgeführt. Im Jahre 1900 wurde mit Hilfe einer Kollekte in der Krim und einer Spende der Gräfin ein Neubau aufgeführt, der 1927 wieder vergrößert wurde.
Die Lehrer wechselten häufig; lange blieben Daniel Erdmann (1885 bis 1894), Jakob Kraft (1896 bis 1901) und Edmund Darner (1928 bis 1940). Wir gedenken aller Lehrer in Ehrfurcht, die auf solchen einsamen Posten ihre Pflicht erfüllten. Die Lehrer in den großen Gemeinden wissen nicht, was sie diesen voraushatten.
Verwaltungsmäßig herrschte bis zum Anschluss an die Wolost 1881 in Josefsdorf ein Durcheinander, bis die Schulzen auf drei Jahre gewählt wurden. Ihre Aufgabe in der Pachtzeit war nicht einfach. Sie saßen zwischen zwei Stühlen: zwischen den Zwischenpächtern und der Gemeinde. Es steht uns nicht zu, zu urteilen, wieweit die Gemeinde Kurudschika ihre Aufgabe erfüllt hat. Im Vergleich aber zu den übrigen Gemeinden auf Pachtland und im Blick auf die hier obwaltenden besonderen Umstände, braucht sie sich „vor keinem seiner Nachbarn zu schämen".
Nach der Kartei festgestellte Verluste unter den Zivilpersonen (Stand vorn 31. Dezember 1964)
Verschleppte : 1
Auf der Flucht und in der Verschleppung Verstorbene: 10
Heimatbuch der Bessarabiendeutschen bearbeitet und herausgegeben von Pastor Albert Kern, Seiten 308-310