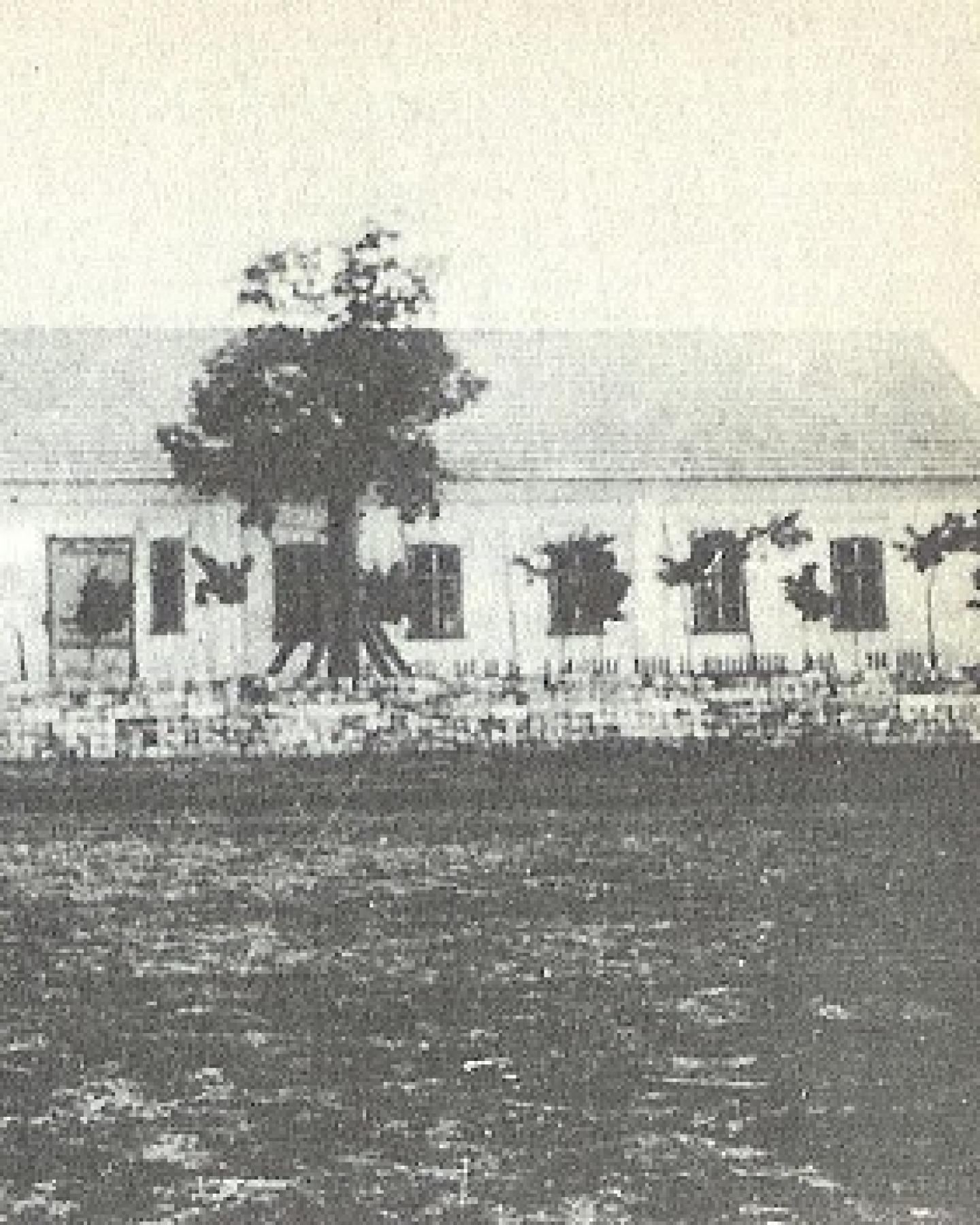Bedeutung des Namens
Lokalisierung
Ukraina
Einwohner
Volkszählung 1930: 665 Deutsche / 10 Andere
Einwohner 1940: 707 Deutsche
Karte
Glaubensrichtung
Kirchlich gehörte Kolatschowka bis 1926 als Nebengemeinde zum Kirchspiel Tarutino und seit 1926 als Hauptgemeinde zu dem neugegründeten Kirchspiel Leipzig. Während die Gemeinde früher als Nebengemeinde nur zwei- bis dreimal vorn Pastor bedient wurde, hatte sie seit 1926 als Hauptgemeinde einen geregelten und häufigeren Besuch des Kirchspiels-Pastors. Die schulischen Verhältnisse waren geordnet. Bis 1918 war in der Gemeinde nur ein deutscher Lehrer angestellt, nachher auch ein rumänischer. Es musste bei nur einem Klassenraum und 120 Schülern am Vor- und Nachmittag unterrichtet werden. Außer der Volksschulbildung erhielten sieben Schüler Oberschulausbildung, von ihnen wurden zwei Volksschullehrer.
aus: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen bearbeitet und herausgegeben von Pastor Albert Kern, Seiten 306-308
Hauptbeschäftigung
Das Handwerk stellte in Kolatschowka: einen Tischler, zwei Schmiede, einen Schuster, einen Sattler, zwei Schneider und einen Faßbinder. Der Handel und die Industrie waren vertreten durch eine Dachziegelei, eine Windmühle, eine private und eine Gemeindemolkerei und ein Konsumladen. Die Gemeinde hatte für den Eigenbedarf, was sie brauchte. Die Hauptbeschäftigung blieb die Landwirtschaft. 1918 war eine totale Mißernte; in den Jahren 1923 bis 1927 waren schwache bis mittlere Ernten, worauf bis 1932 gute Ernten folgten. 1932 vernichtete Hagelschlag die ganze Wein- und ein Drittel der Getreideernte.
Das Katastrophenjahr im Kogälniktal 1927 hat auch im Tale Skinos große Schäden verursacht. Dank seiner günstigen Lage blieb es in Koiatschowka nur bei Sachschaden.
aus: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen bearbeitet und herausgegeben von Pastor Albert Kern, Seiten 306-308
Historie
Die Gemeinde Kolatschowka, die 1908 gegründet wurde und ihren russischen Namen in abgewandelter Form (Colaceni) auch in der rumänischen Ära behielt, hatte in ihren Mauern einen Helden, der wie viele andere im deutschen Siedlungsgebiet die oben gezeigte Gesinnung im Ersten Weltkrieg zeigte, obwohl er schon der jüngsten Generation angehörte: Oskar Bohnet. Nach der Überschreitung der russisch-österreichischen Grenze vom 8. auf 9. August 1914 nahm er an dem Gefecht teil, übernahm das Kommando nach dem Ausfall des Kommandeurs und wurde für diesen heldenhaften Einsatz ausgezeichnet. Sein Einsatz verschonte die Gemeinde von der Enteignung, die 1915 in allen deutschen Gemeinden durch die Liquidationsgesetze vom 2. Januar und 13. Februar 1915 theoretisch vollzogen war. Diese grundsätzlichen Ausführungen sind absichtlich bei einer der kleinsten Tochtergemeinden gemacht worden, zum Beweis dafür, dass die gekennzeichnete Haltung der deutschen Kolonisten der Obrigkeit gegenüber bis in die kleinste Gemeinde die gleiche war.
Kolatschowka war eine Tochtergemeinde auf gekauftem Land. Die Gründer waren: H. Bohnet, A. Widrner, E. Erdmann, J. Künzle, Alex. Widmer, G. Mogck, J. Mogck, N. Tschritter, Chr. Göhring, M. Rotacker, J. Nitschke, J. Flaig, D. Irion, J. Bender, W. Müller, Fr. Müller, J. Flegel, J. Burkhart, Marie Widmer, G. Schöck, J. Leischner, Chr. Verwied, G. Bross, N. Quiram, J. Neumann, J. Lächelt, J. Pahl, J. Lämke, Fr. Fiechtner, M. Neumann.
Wir sehen unter ihnen Siedler aus Leipzig, Kulm, Alt-Posttal, Tarutino, aber auch aus Paris und Brienne.
Das Land, 3310 Hektar, wurde in 57 Parzellen zu je 54 Hektar aufgeteilt. Die Qualität des Bodens im Skinostal war gut und die Wirtschaftsweise der Ansiedler fortschrittlich. Auch das Gemeinwesen gedieh durch einen Gemeindespruch, der bei der Errichtung von Baulichkeiten für Kirche, Schule und Gemeindewirtschaft zu Fronarbeit verpflichtete. So entstanden das Bethaus mit Küsterwohnung, zugleich Schule und Lehrerwohnung; dazu ein Gebäude mit einem Schulraum, und Wirtschaftsräume für den Lehrer, weiter die Gebäude für die Gemeindewirtschaft.
Der sichtbare Fortschritt der Gemeinde fand mit der Umsiedlung ein unerwartetes Ende. Das Tal war allen ans Herz gewachsen, das zeigte der letzte Blick vom Treckwagen.
Nach der Kartei festgestellte Verluste unter den Zivilpersonen (Stand vom 31. Dezember 1964)
Verschleppte: 34
Auf der Flucht und in der Verschleppung Verstorbene: -
aus: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen bearbeitet und herausgegeben von Pastor Albert Kern, Seiten 306-308