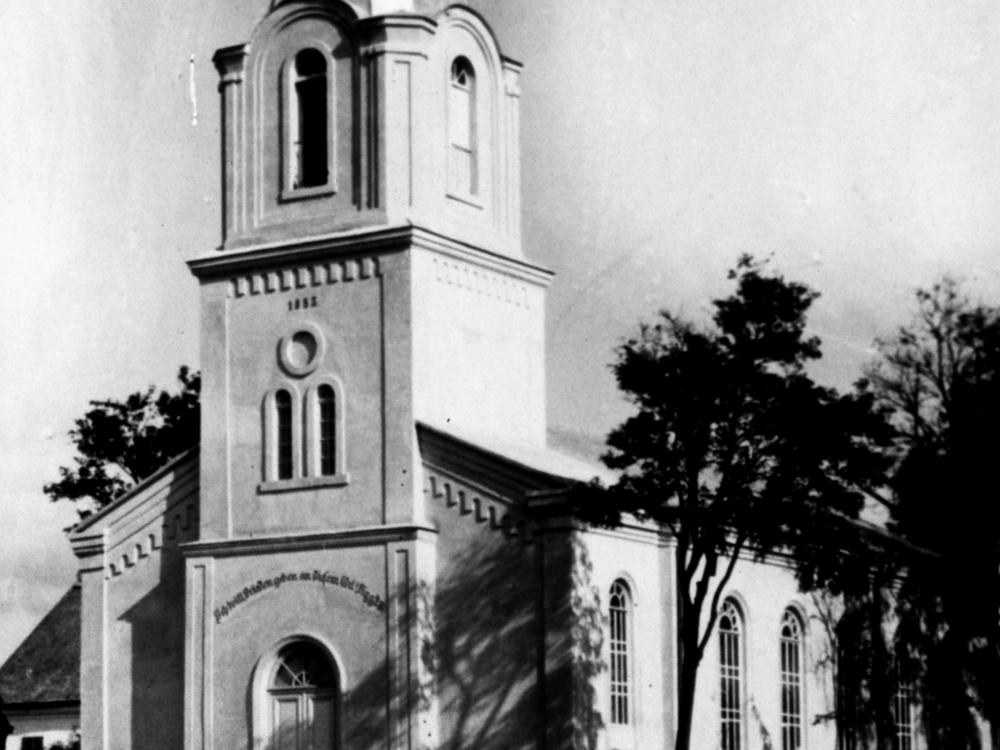Geschichte der Bessarabiendeutschen

Wichtige Ereignisse aus der Geschichte der Bessarabiendeutschen

Idealisierte Darstellung der Einwanderung mit der Bildunterschrift: Das ist die neue Heimat! Deutschen Kolonisten wird im Schwarzmeergebiet Land angewiesen.
Archivbild IN 300907
Tabelle nach: R[udolf] Weiß, Kalender 1949, Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien und der Dobrudscha [Stuttgart], S.49
1813 |
Bekanntmachung des Kaisers Alexander I. über die Ansiedlung der Kolonisten. |
1814 – 1817 |
Erste Siedlungsperiode. Gründung der Gemeinden Tarutino, Borodino, Krasna, Klöstitz, Kulm, Leipzig, Wittenberg, Arzis, Brienne, Paris, Beresina und Teplitz. |
1822 – 1842 |
Zweite Siedlungsperiode. Gründung der Gemeinden Sarata, Gnadental, Lichtental, Friedenstal, Dennewit z, Plotzk und Hoffnungstal. |
1823 |
Tod Christian Friedrich Werners (23. September) |
1829 |
Pest in Bessarabien |
1833 |
Einführung der Getreidemagazine |
1844 |
Eröffnung der Wernerschule in Sarata |
1845 |
Tod des Vorsitzenden des Fürsorgekomitees, General Insow. Ernennung des Staatsrates W. v. Hahn zum Vorsitzenden. |
1846 |
Gründung der „Unterhaltungsblätter“ in Odessa |
1849 |
Einführung der Brandordnung |
1854/55 |
Krimkrieg |
1855 |
Das große Schreckensjahr: Dürre, Cholera und Viehseuche |
1858 |
Beginn der inneren Kolonisation |
1863 |
Gründung der „Odessaer Zeitung“ |
1865 |
Erste Tuchfabrik (in Tarutino) |
1866 |
Eröffnung des „Alexander-Asyls“ in Sarata. Einführung der Landschaftsämter. |
1868 |
Eröffnung des deutschen Krankenhauses in Sarata |
1869 |
Gründung der ersten Waisenkasse (in Klöstitz) |
1871 |
Auflösung des Fürsorgekomitees und Aufhebung der Privilegien, Gründung neuer Gebietsämter |
1874 |
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, Einführung der Mähmaschinen |
1876 |
Erste Dampfmühle (in Sarata) |
1877 |
Bau der ersten Eisenbahnlinie durch das Siedlungsgebiet (Bender - Reni) |
1877/78 |
Russisch-türkischer Krieg |
1880 |
Übernahme der Schulen durch das Ministerium. Beginn der Russifizierung |
1888 |
Erster Frauenverein (Klöstitz) |
1889 |
Erste Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen (Sarata) |
1897 |
Gründung des ersten Konsumvereins (in Sarata) |
1899 |
Großes Hungerjahr |
1905 |
Russisch-japanischer Krieg. Manifest der Freiheiten. Massenhafte Auswanderung. Erste Tarutioner Ausstellung. |
1906 |
Eröffnung der höheren Mädchenschule in Tarutino. Erste Gesellschaft gegenseitigen Kredits. |
1908 |
Eröffnung des Knabengymnasiums in Tarutino |
1909 |
Erste Kleinkreditgesellschaft |
1914 |
Bau der Eisenbahnlinie Akkerman. |
| Ausbruch des 1. Weltkriegs | |
1915 |
Die russischen Liquidationsgesetze. Verbot der deutschen Sprache. Landenteignungsgesetz |
1917 |
Kongress der Deutschen in Odessa (14. - 16. Mai) |
Umsturz in Russland (7. Nov.), Autonomie in Bessarabien |
|
1918 |
Anschluss Bessarabiens an Rumänien (29. März). Zusicherung der deutschen Sprache in den deutschen Schulen. |
1919 |
Gründung des ev.-luth. Konsistoriums in Tarutino (2. Jan.). Einsetzung des bessarabischen deutschen Komitees (13. Juni). Gründung der deutschen Zeitung Bessarabiens (6. Nov.) |
1920 |
Agrarreform. Deutscher Volksrat für Bessarabien. |
1921 |
Gründung des Wirtschaftsverbandes |
1922 |
Gründung des Sarataer Museums |
1923 |
Bau des Mühlenwerks „Progreß“ in Beresina. Gründung der Bank für Handel und Industrie in Tarutino. Große Überschwemmung im Kogälniktal. |
1924 |
Gründung von Bad Burnas. Einführung der Gemeinderäte nach rumänischem Gesetz. |
1925 |
Anschluss an die evang. Kirche Siebenbürgens |
1929 |
Notstandsanleihe im Reich |
1933 |
Gründung des Verbandes der Kulturvereine. Umschuldungsgesetz |
1934 |
Wahl von Dr. Broneske zum Vorsitzenden des Volksrates. Eröffnung der Lehrgänge in Arzis. |
1935 |
Gründung des „Deutschen Volksblatt“ (9. Februar). Neues Volksprogramm für die Deutschen in Rumänien (22. Okt.). Ein Sonderzug mit 450 Schulkindern und 150 Arbeitslosen nach Siebenbürgen (17. Okt.). Erster Volkstag in Tarutino (17. Nov.) |
1936 |
Bauerntag in Arzis (27. Sept.) |
1937 |
Volkstag in Teplitz (24 Okt.) |
1938 |
Erster Berufswettkampf der Jugend |
1939 |
Anerkennung der konfessionellen Schulen (4. Feb.). Gründung des Handwerkervereins (12. März). Umgestaltung der „Bank für Handel und Industrie“ in eine Großbank. Rückgabe der Schulgebäude an die Gemeinden (19. Sept.). Umgestaltung des Wirtschaftsverbandes in eine „Federale der deutschen Genossenschaften“ unter dem Namen „Landwirt“ (Okt.). |
Beginn des 2. Weltkriegs |
|
1940 |
Besetzung Bessarabiens durch die Russen (26. Juni). |
Auswanderung
Nach einer 350-jährigen Türkenherrschaft kam das viel umstrittene Land Bessarabien durch den Frieden von Bukarest am 28. Mai 1812 zu Russland.
Die Türken wanderten darauf nach der Dobrudscha und der Türkei aus. Die weite Steppe Bessarabiens war unbebaut und nach dem Abzug der Türken unbewohnt; überhaupt bot das Land ein Bild der Verheerung und Verwilderung. Wie schon früher die russische Kaiserin Katharina II. ausländische Kolonisten ins Land gerufen hatte (Manifest vom 22. Juli 1763), um sie an der Wolga anzusiedeln und die verwilderten Steppen zu kultivieren, so war es jetzt Alexander I., der in seinem Manifest vom 20. Februar 1804 den deutschen Einwanderern weitgehende Vorrechte zugestand. In seinem Aufruf vom 29. November 1813 sicherte er den Kolonisten folgende Privilegien zu:
- zehn Jahre lang frei von allen Abgaben und Grundsteuern
- jeder Familie werden 60 Desjatinen = ca. 66 ha Land zugeteilt
- unbefristete Befreiung vom Militärdienst
- Religionsfreiheit u. a.
(zusammengefasster Auszug aus: Immanuel Wagner, Geschichte der Gründung der Kolonie Sarata)
Auswanderungsgründe
Die deutschen Siedler kamen vorwiegend aus Württemberg. Die napoleonischen Kriege hatten zu unerträglich hohen Abgaben geführt. Unter den französischen Besatzungstruppen hatte die schwäbische Bevölkerung schwer zu leiden. Dazu kamen Dürrezeiten, die zur Verarmung und zu Hungersnöten beigetragen hatten. Entscheidend bestärkten auch religiöse Beweggründe den Auswanderungswunsch: große Unzufriedenheit der Pietisten mit der Entwicklung in der Kirche.
Auswanderungswege
Die größte Gruppe der Einwanderer kam nach Zar Alexander I. Aufruf entweder auf dem Landweg über Schlesien – Lemberg oder mit „Ulmer Schachteln“ auf der Donau nach Bessarabien.
Eine andere Gruppe bestand aus den sog. „Warschauer Kolonisten“:
Bereits nach der ersten Teilung Polens (1772) benötigte der Preußenkönig Friedrich II. Siedler für das neugewonnene Gebiet nördlich von Thorn. Ihnen wurden heruntergekommene Bauernhöfe und kleine Vorwerke zugeteilt. Zu den ersten Auswanderern, die bereits 1782 aus Württemberg nach „Preußisch-Polen“ zogen, gehörten z.B. die Familien Blum aus Frutenhof, Bohnet aus Unter-Musbach, Eberle aus Maichingen und viele mehr.
Erst unter der Regentschaft des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. entstanden ab 1799 - 1806 die neugegründeten Schwabensiedlungen um Kalisch, Lodz und Warschau herum, die heute noch vorhanden sind.
Nach der territorialen Neugestaltung der Grenzen durch Napoleon I. ab 1806, es entstand das Herzogtum Warschau wieder, verloren diese Kolonisten alle preußischen Privilegien und hatten unter den Großgrundbesitzern Polens und dem katholischen Klerus sehr zu leiden. Dazu kam 1812 der Feldzug Napoleons nach Russland, wodurch dieses Gebiet zweimal in große Mitleidenschaft gezogen wurde. In dieser Situation kam den Menschen die Einladung Zar Alexander I. zur Weiterwanderung nach Bessarabien sehr entgegen.
Zusammen mit Norddeutschen aus Westpreußen, Brandenburg, Mecklenburg und Pommern wanderten diese Württemberger aus „Preußisch-Polen“ in Bessarabien ein.

Auswanderungswege der Bessarabiendeutschen
In Bessarabien 1814 bis 1940
In den Jahren von 1814 bis 1842 wanderten rund 9 000 Menschen nach Bessarabien ein und gründeten 25 Mutterkolonien. Durch Binnenwanderung entstanden daraus 150 deutsche Gemeinden mit einem Landbesitz von über 300 000 ha fruchtbaren Bodens.
„Aufgrund der vorgegebenen Einwanderungsbedingungen siedelte die
Mehrzahl der Bessarabiendeutschen in Dörfern. Noch im Jahr 1932 lebten nur ca. 1,05 % in Städten wie Kischinew, Akkerman und Bendery. Die Dörfer, selbst die Zentren der Bessarabiendeutschen wie Tarutino, Sarata und Arzis,
behielten ihren ländlichen Charakter, selbst dann, als gegen Ende des
19. Jahrhunderts auch in Bessarabien die Industrialisierung einsetzte.
Das ethnische Erscheinungsbild dieser Ortschaften war – bis auf
Marktzentren wie Tarutino, Arzis und Sarata und die Tochtergründungen
außerhalb des ehemals geschlossenen deutschen Siedlungsgebietes – ausschließlich durch die deutsche Bevölkerungsgruppe geprägt …“
Noch im Jahr 1930 arbeiteten ca. 81 % der Bessarabiendeutschen in der Landwirtschaft und ca. 12 % im Handwerk. Die restlichen 7 % verteilten sich auf Handel und Industrie, auf geistige Berufe, hauptsächlich Lehrer, Pastoren und Ärzte sowie auf sonstige Berufszweige...
Das dörfliche Leben war im großen und ganzen geprägt durch seine regelmäßig wiederkehrenden, jahreszeitlich bedingten Arbeiten, Sitten und Gewohnheiten, einschließlich der religiösen Gebräuche, sowie durch die lebensgeschichtlichen Einschnitte mit ihren kirchlich begleiteten Riten. Unterbrochen wurden diese gewohnten Regelmäßigkeiten nur durch Kriegszeiten und schwere Epidemien. Die massivste Erschütterung erfuhr diese Ordnung durch den 1. Weltkrieg und die damit verbundenen Auswirkungen (siehe Auflistung: wichtige geschichtliche Ereignisse), die nicht nur eine kirchliche Neuorientierung, sondern auch die Entwicklung einer Gruppenidentität erzwang."
Cornelia Schlarb, Deutsche Gemeinden in Bessarabien 1814–1940, Jahrbuch 2000, S. 17ff
Umsiedlung 1940
Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fordert Russland Bessarabien, das 1918 an Rumänien abgetreten werden musste, wieder zurück. Mit dem geheimen Zusatzprotokoll zum „Hitler-Stalin-Pakt“ vom 23. August 1939 ist das Schicksal der Bessarabiendeutschen, die Umsiedlung ins „Großdeutsche Reich“, vorgezeichnet. Eine akzeptable Alternative zur Umsiedlung war nicht gegeben.
Die entscheidende Textstellen beim Aufruf des deutschen Bevollmächtigten für die Umsiedlung:

Ausschnitt aus dem Aufruf des deutschen Bevollmächtigten
Archivbild IN 107828
Organisiert von der aus dem Reich angereisten Umsiedlungskommission verlassen die Bessarabiendeutschen innerhalb eines Monats in Lastwagen, per Bahn oder Pferdetreck auf vorher festgelegten Routen durch die Grenzorte Galatz, Reni und Kilia ihre Heimat.
In Galatz werden Treckwagen (11 508) und Pferde (22 505) abgeliefert und die Umsiedler wie auch in Reni und Kilia auf Donaudampfer eingeschifft.
Nach drei bzw. sechs Tagen legen die großen Schiffe im Hafen von Prahovo und die kleineren, die das Eiserne Tor passieren können, in Semlin an. Hier werden die Bessarabiendeutschen in den Durchgangslagern in Großzelten untergebracht und von Donauschwaben aus dem jugoslawischen Banat betreut.
Von den Donauhäfen Prahovo und Semlin geht es mit dem Zug in die etwa 250 Lager im Süden des Deutschen Reiches, wobei die Dorfgemeinschaften mit der Einweisung in verschiedene Lager zwangsläufig auseinander gerissen werden.
„Die Behinderten wurden [in getrennten Transporten] in staatliche Einrichtungen verbracht und fielen dort den Tötungsaktionen zum Opfer." Arnulf Baumann, Die Deutschen aus Bessarabien, S. 24/25
Nach drei- bis sechswöchiger Quarantänezeit in den Lagern der Volksdeutschen Mittelstelle (VoMi) erfolgt der erste Kontakt mit den politischen Gegebenheiten des Deutschen Reiches.
Später haben die Umsiedler die Möglichkeit zu arbeiten und so dem bedrückenden Lagerleben für einige Stunden zu entfliehen.
In den Lagern werden die Bessarabiendeutschen der „Durchschleusung“ (Einteilung in A- oder O-Tauglichkeit nach „rassischen“ und politischen Gesichtspunkten) unterzogen. Nach der Einbürgerung werden sie je nach Eingruppierung im Altreich oder als Hoffnungsträger der Nationalsozialisten mit „Naturalrestitution“ (die polnischen und jüdischen Bewohner werden dazu auf rabiate Weise enteignet) in den neubesetzten Ostgebieten (Westpreußen, Wartheland) angesiedelt.
(Statistik zur Ansiedlung: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/umsiedlung-statistik.pdf)
(siehe dazu auch z.B. Dirk Jachomowski, Die Umsiedlung der Bessarabien-, Bukowina- und Dobrudschadeutschen, 1984, R. Oldenbourg Verlag München, Bibliothek Heimatmuseum oder Ute Schmidt, Die Deutschen aus Bessarabien, S.199ff)
Lageraufenthalt 1940-1941
Zunächst ein Auszug aus der zeitgenössischen NS-Propaganda
„In den Lagern der Gaue Steiermark, Oberdonau, Niederdonau, Bayern, Württemberg, Baden, Bayrische Ostmark, Thüringen, Sachsen, Sudetenland finden die zurückgekehrten Volksgenossen Aufnahme. Auf den mit Blumen geschmückten Bahnhöfen rollen die Züge ein. - Herzlicher Empfang, Musik und frohes Willkommen nehmen die von der langen Fahrt müde gewordenen Bessarabiendeutschen ganz gefangen. Endlich sind sie da, auf dem Boden ihres deutschen Vaterlandes … Gewaltig ist die Zahl der Lager, die in den verschiedenen Gauen des Deutschen Reiches eingerichtet worden sind …
Alle Lager werden zentral von der Volksdeutschen Mittelstelle verwaltet und von den Gliederungen der Partei betreut. Die NSV. sorgt für eine ausreichende Verpflegung, die Gaupropagandaämter für die weltanschauliche Schulung, die Gaufilmstellen für Unterhaltung. Kostenlos stellt der Reichsverband der deutschen Presse Zeitungen und Zeitschriften zur Verfügung, HJ. und BDM. veranstalten Feierstunden, Unterhaltungsabende und nehmen die volksdeutsche Jugend in ihre Betreuung. Während der Lagerzeit wird der größere Teil der Volksdeutschen bis zur endgültigen Ansiedlung in vorübergehende Arbeitsplätze vermittelt. Nach der völkischen Überprüfung und Verleihung des Reichsbürgerbriefes erfolgt die Wiederansiedlung.“
aus Andreas Pampuch, Heimkehr der Bessarabiendeutschen, Schlesien-Verlag Breslau 1941, S. 232, Bibliothek Heimatmuseum
Die ernüchternde Realität
"Die mit dem Lagerleben verbundenen persönliche Einschränkungen
mußten in Geduld, Einsicht und oftmals mit großer Nachsicht ertragen
werden. Die für alle Umsiedlungslager verfügte sechswöchige Quarantäne
war für die Insassen besonders hart. Dazu kam die Umstellung auf das
Lageressen und das Untätigsein.
In einigen Lagern waren in einem
Raum 100 bis 180 Personen, Erwachsene und Kinder, untergebracht. Auf
Holzpritschen mit aneinandergereihten Strohsäcken lag Familie neben
Familie.
Nach der Quarantänezeit konnten den
arbeitsfähigen Insassen Arbeitsplätze oder Gelegenheitsarbeiten
vermittelt werden. Den Schülern wurde der Schulbesuch ermöglicht."
Christian Fiess, Heimatbuch Sarata, S. 644
Auszüge aus selbsterlebten Berichten oder Erzählungen:
Die Lager "waren dort eingerichtet wo es Platz gab, in Schulen,
Fabriken, oder wo es sonst leere Räume gab. Das Personal für die Leitung
und Betreuung konnte in der Kriegszeit nicht in Ruhe ausgesucht
werden; man musste nehmen, wer da war. Bei der Leitung wurde kaum auf
einschlägige Berufserfahrung geachtet, sondern vor allem auf stramme
Gesinnung. Daraus entstanden viele Konflikte.
Unsere Familie war
zunächst in einem Gutshof in Rüdigershafen ... untergebracht: Neun
Personen aus zwei Familien mussten in Doppelstockbetten schlafen, die
fast den ganzen Raum einnahmen. Auf Mann oder Frau, jung oder alt, wurde
keine Rücksicht genommen; in anderen Räumen waren noch mehr Personen
beieinander.
Der Esssaal durfte nur zu den Mahlzeiten betreten
werden. So waren die engen Flure und der Hof die einzigen
Aufenthaltsräume, im Winter meist nur die Flure. Die Erwachsenen hatten
keine Arbeit. Für die an harte Arbeit gewohnten Umsiedler war diese
erzwungene Untätigkeit quälend. Frauen konnten sich ein wenig nützlich
machen, Männer fast gar nicht. Lagerkoller war die Folge - immer wieder
flackerte Streit auf, aus nichtigem Anlass.
Für die Kinder gab es weder Betreuung noch Schule; wir waren uns selbst überlassen."
Arnulf Baumann, Die Lagerzeit, Jahrbuch 2005, S. 21ff
"Familien wurden schon beim Verlassen der Heimatdörfer getrennt. Die
Frauen, jetzt auf sich gestellt, trafen oft eigene Entscheidungen, weil
die Männer erst Wochen später in die Lager nachkamen. Das neue
Zusammenleben war eine große Belastung für die Menschen, vor allem für
die Frauen. Es gab keinen privaten Ort des Rückzuges. In Klassenräumen
oder anderen großen Zimmern lebten und schliefen sie mit fremden
Familien zusammen. Das ungewohnte Essen und die seelischen Belastungen
führten zu Krankheiten, vor allem der Schwächsten. Welch menschliche
Tragödien haben sich in manchen Familien abgespielt. Kinder starben. So
war z.B. Familie Johannes und Helene Kelm mit vier Kindern auf den
Umsiedlungsweg gegangen. Im Lager starben ihre vier Kinder."
Leonide Baum, Wie haben sie es nur geschafft? (Im Osten), Jahrbuch 2005, S. 30ff
Ansiedlung im Osten 1941-1944
"Die konkreten Erfahrungen mit dem Sowjetsystem wie auch das idealisierte Deutschlandbild und das Vertrauen auf das von der NS-Regierung gegebene Versprechen, den Umsiedlern "in Deutschland" wieder eine neue Heimat zu schaffen, waren die Hauptgründe dafür, dass sich die deutsche Minderheit Bessarabiens fast komplett auf das Umsiedlungsprojekt eingelassen hatte.
Tatsächlich war das gesamte Umsiedlungsverfahren vom zynischen und instrumentellen Charakter der nationalsozialistischen Siedlungs- und Bevölkerungspolitik bestimmt. Den NS-Strategen ging es nicht in erster Linie um die Sicherung des Überlebens deutscher Minderheitsgruppen, deren Heimatgebiete infolge des so genannten "Hitler-Stalin-Paktes" vom 23. August 1939 (...) der sowjetischen Interessensphäre zufallen sollten. (...) Der fatale Doppelcharakter der Umsiedlung bestand vielmehr gerade darin, dass sie den betroffenen auslandsdeutschen Gruppen zwar als "Rettungsaktion" erschien, dem NS-Regime aber faktisch als Einstieg in eine langfristig angelegte Siedlungs-, Vertreibungs-, "Umvolkungs"- und Vernichtungspolitik diente. Für die nationalsozialistischen Bevölkerungsingenieure waren die Umsiedler aus Ost- und Südosteuropa vor allem Menschenreserven und Arbeitskräftepotenziale, die sie zur langfristigen Befriedung und Kolonialisierung der Okkupationsgebiete in Ostmitteleuropa einsetzen wollten."
"Unter den im "Warthegau" und in "Danzig-Westpreußen" gegebenen Bedingungen konnten die Bessarabiendeutschen im besetzten Polen keine neue Heimat finden."
Auszüge aus: Ute Schmidt, Die NS-Politik und die Umsiedler, Jahrbuch 2007, S. 131.
Weitere sehr interessante Informationen zum Thema Ansiedlung im Osten sind unter http://www.dfg.de/pub/generalplan/download.html zu finden. (Nicht mehr online)
Hier zwei kurze Auszüge aus der Dokumentation:
"Ziel des Generalplans Ost war eine ethnische Homogenisierung des von verschiedenen Völkern bewohnten Osteuropa – vor allem unter Ausschluss des jüdischen Bevölkerungsanteils. Mit diesem Projekt einer gewaltsamen „Umvolkung“ verband sich die Hoffnung, einen deutsch besiedelten Osten zum Ausgangspunkt einer Erneuerung des deutschen „Volkes“ zu machen."
"Schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatten verschiedene Institutionen Pläne für eine Erweiterung des Deutschen Reiches nach Osten entworfen. Die Richtung hatte Adolf Hitler in seinem Buch „Mein Kampf“ vorgegeben. Die Deutschen, so hieß es dort, hätten die Pflicht, sich den „Lebensraum“ kulturell und „rassisch minderwertiger“ Völker anzueignen. Diese auf den Ostraum gerichteten Überlegungen waren ein Novum. Großräumige Planungen hatte es bis dahin nur für überseeische Kolonien gegeben. Nun wurden diese kolonialen Vorstellungen auf Europa übertragen und konsequent radikalisiert. Neu waren vor allem der umfassende Anspruch und die Detailliertheit der Pläne. Man wollte nicht nur Land und Rohstoffe einer Region in Besitz nehmen und die dort lebenden Menschen als billige Arbeitskräfte nutzen, vielmehr sollte der verplante Raum gestalterisch erobert werden. Das schloss die Deportation und Umsiedlung von Millionen Menschen ein."
Flucht Januar 1945
So wie die übrige deutsche Bevölkerung im Osten des Reiches hatten zu Beginn der zweiten Januarhälfte 1945 mit dem Herannahen der Front auch die Umsiedler aus Bessarabien den Evakuierungsbefehl (treffender wäre der Begriff Fluchterlaubnis) erhalten. Überall brachen die Trecks auf und zogen durch Eis und Schnee in Richtung Westen. Es war eine Evakuierung der Zivilbevölkerung vor der herannahenden Front; es war gleichzeitig eine Flucht der Zivilbevölkerung vor dem, was die Zurückbleibenden in der folgenden Zeit erwartete: eine Welle von Mord, Plünderung und Vergewaltigung, Deportation zur Zwangsarbeit nach Sibirien ... .

Provisorische Unterkunft auf der Flucht (Repro aus Frankfurter Illustrierte 10.4.1954)
Archivbild IN 136302
Die meisten bessarabiendeutschen Umsiedler gelangten 1945 auf ihrer Flucht nach Deutschland - ein kleinerer Teil wurde nach Sibirien verschleppt oder wieder nach Rumänien zurückgeführt.
(teils zusammengefasster Textauszug aus Dirk Jachomowski, Die Umsiedlung
der Bessarabien-, Bukowina- und Dobrudschadeutschen, 1984, R. Oldenbourg
Verlag München, Bibliothek Heimatmuseum)

Habseligkeiten bei der Flucht auf einen Schlitten geschnallt (Repro aus Frankfurter Illustrierte 10.4.1954)
Archivbild IN 136300
Auszug aus einem Erlebnisbericht:
"Mit Mühe konnten wir, Tante Maria und ich, uns einreihen in die Flüchtlingskolonne. Da gab es keine Geschlossenheit mehr. ... Wir fuhren Richtung Grenzhausen im Schneckentempo. Immer wieder mußten wir anhalten und lange stehen bleiben. Wir wußten nicht, was sich da vorne abspielte. Es war eine unübersehbare Schlange von Fuhrwerken und Militärfahrzeugen dazwischen.
Plötzlich näherte sich ein Flugzeug. Es eröffnete das Feuer auf die Fahrzeuge; so wußten wir nun also, daß es ein russisches Flugzeug war. Ich schrie: "Runter vom Wagen!" Fritz war sofort unten und schon hinten, der Mutter beim Absteigen zu helfen. Ich sprang auch über den Wagen und half der Tante Emma. Alle rannten davon in eine Richtung. Das Lieschen, in Mänteln verpackt, schrie: "Papa!" Ich holte sie aus den Mänteln heraus und half ihr vom Wagen herunter. In dem Moment hörte ich einen starken Knall..."
Flucht aus dem Wartheland, erzählt von Otto Büchle, Jahrbuch 2007, S. 174 ff.
Neubeginn
Weitaus die meisten Bessarabiendeutschen finden in den westlichen Besatzungszonen ein neues Zuhause, wo sie am Wiederaufbau des im Krieg zerstörten Deutschlands mitwirken.
Bessarabiendeutsche in den vier Besatzungszonen
(Stand: 1.12.1948)
aus Ute Schmidt, Die Deutschen aus Bessarabien
- Amerikanische Zone 26.366 (davon in Württemberg: 20.116)
- Britische Zone 23.989
- Sowjetische Zone 13.360
- Französische Zone 450
Mit besonderem Engagement setzte sich Karl Rüb für die Zuzugsgenehmigungen für
Bessarabiendeutsche nach Württemberg ein. Neben verschiedenen anderen Lagern konnten in Stuttgart-Zuffenhausen, im Lager Seedamm, Wohnungen für Familien mit Pferdegespannen geschaffen werden. Rüb bot dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Klett an, mit diesen Fuhrwerken bei der Trümmerbeseitigung mitzuhelfen und damit einen
Beitrag zum Aufbau der Stadt Stuttgart zu leisten. Hier der historisch bedeutsame Dankesbrief von Dr. Klett an Karl Rüb:
Der Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart Stuttgart, den 18.9.1945
An das
Hilfswerk für ev. Umsiedler
z. Hd. von Herrn Ing. Rüb
Stuttgart
Moltkestr. 87
Sehr geehrter Herr Rüb!
Für Ihre liebenswürdigen Zeilen vom 9.9.45, und für Ihren persönlichen Besuch danke ich Ihnen.
Mit großem Interesse und großer Freude habe ich davon Kenntnis genommen, daß die nach Württemberg und Stuttgart gezogenen Schwabenumsiedler einen Beitrag am Aufbau der Stadt Stuttgart leisten wollen, obgleich sie als unschuldigerweise obdachlos und mittellos gewordene Menschen in ganz besonderer Weise unter der vergangenen Wahnsinnspolitik zu leiden hatten und noch zu leiden haben.
Es erfüllt mich mit Zuversicht, namens der von Ihnen betreuten Schwabenumsiedler die Versicherung entgegennehmen zu dürfen, daß Ihnen immer noch die schwielen Hände, der entschlossene Wille und der noch ungebrochenen Mut geblieben sind, am Aufbau der Stadt Stuttgart und ihres öffentlichen Lebens mitzuarbeiten.
Ich bitte Sie, den Schwabenumsiedlern für diese aufrichtige Bereitwilligkeit meinen besonderen Dank zum Ausdruck zu bringen und sie bitten zu wollen, mit der ihnen eigenen Energie und Tatkraft sobald als möglich die Probleme, die noch zu lösen sind, mit anzufassen und ihre Arbeitskraft und ihre Transportmittel in den Dienst des Wiederaufbaus zu stellen.
Die weiteren von Ihnen angeschnittenen Fragen haben wir ja in persönlicher Aussprache schon behandelt, und ich gebe der Hoffnung Ausdruck, daß die städt. Dienststellen Ihnen und den Schwabenumsiedlern mit Rat und Tat gerne zur Seite gestanden sind und weiterhin zur Seite stehen werden.
Mit verbindlichen Grüßen
gez. Dr. Klett
Der große Wunsch wird von vielen Familien möglichst schnell angegangen:
Wieder ein eigenes Haus
Der Neubeginn bedeutete für die meisten Bessarabiendeutschen eine gewaltige Umstellung: vom Bauern zum Industriearbeiter. Das war ungeheuer schwer, gelang aber den meisten doch. Allerdings kamen die Älteren nicht über den Industriearbeiterstatus hinaus. Dass der einst als völlig verlässliche Grundlage erscheinende Landbesitz sich nach Umsiedlung und Flucht als wenig beständig erwiesen hatte, war eine harte Lektion. Das setzte bei den Bessarabiendeutschen ein starkes Streben nach höherer Ausbildung in Gang, eine Tendenz, die sich seither fortgesetzt und zu einer völligen Umschichtung der beruflichen Gliederung geführt hat. (aus Arnulf Baumann, Die Deutschen aus Bessarabien)
Aus dem Grußwort von Dr. Wolfgang Schuster, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, anlässlich des Jubiläums "50 Jahre Heimatmuseum der Deutschen aus Bessarabien" am 22. November 2002 im Rathaus Stuttgart:
Vor 50 Jahren lag diese Stadt noch weitgehend in Trümmern. 80 % der Innenstadt wurden ja
durch den 2. Weltkrieg weitgehend zerstört, und es waren eben auch die
Bessarabiendeutschen, die zu uns gekommen sind, die angepackt haben,
die immer geschafft haben, und deshalb bin ich ganz, ganz dankbar Ihnen,
dass Sie den Wiederaufbau mit bewerkstelligt haben, auf dem wir, die
jüngere Generation, aufbauen können.
Am 22. Juli 1954 übernimmt die Landeshauptstadt Stuttgart die Patenschaft für die Bessarabiendeutschen.